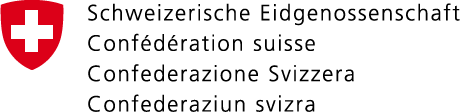Die EU hatte am 14. Mai 2024 zehn Verordnungen und Richtlinien verabschiedet, die zusammen den neuen Migrations- und Asylpakt bilden. Ziel der Reform ist es, die irreguläre Migration nach Europa einzudämmen und über harmonisierte und effiziente Asylverfahren die Sekundärmigration innerhalb des Schengen-Raums zu verringern. Schliesslich sollen Schengen-Mitgliedstaaten mit hohem Migrationsduck durch die solidarische Verteilung von Asylsuchenden und andere Arten der Unterstützung entlastet werden. Der Bundesrat begrüsst diese Reform. Seiner Ansicht nach hat die Schweiz aufgrund ihrer geografischen Lage ein vitales Interesse an einer funktionierenden und möglichst krisenresistenten europäischen Migrations- und Asylpolitik.
Neue Regeln im Dublin-Bereich
Fünf der zehn Rechtstexte sind für die Schweiz ganz oder teilweise verbindlich. Darin wird unter anderem geregelt, welcher Dublin-Staat für die Prüfung eines Asylgesuches zuständig ist. Die heutigen Zuständigkeitsregeln bleiben grundsätzlich die gleichen. Es gelten jedoch kürzere Fristen für die Klärung der Zuständigkeit. Dadurch können Asylsuchende rascher an einen anderen Staat überstellt werden. Um Sekundärmigration zu vermeiden, wird der Bezug eines Gesuchstellers zu einem bestimmten Dublin-Staat besser berücksichtigt, gleichzeitig aber auch der Übergang der Verantwortung für ein Asylgesuch von einem an einen anderen Dublin-Staat erschwert. Die neue Krisenverordnung legt fest, wie die Staaten in Ausnahmesituationen vorübergehend von bestimmten Regeln abweichen können, etwa durch längere Dublin-Verfahren.
Die revidierte Eurodac-Verordnung stellt die Interoperabilität mit anderen europäischen IT-Systemen sicher. Die Datenbank enthält neu die Gesichtsbilder und Fingerabdrücke aller Personen ab dem sechsten Altersjahr sowie zusätzliche Personenkategorien. Zudem führt der Pakt ein Verfahren für eine schnelle Überprüfung von Personen aus Drittstaaten ein, die in den Schengen-Raum eingereist sind, ohne die Einreisevoraussetzungen zu erfüllen. Die zuständigen Behörden sollen damit die Identität feststellen, einen Sicherheitscheck durchführen und vor Ort gesundheitliche Probleme erfassen.
Freiwillige Unterstützung
Mit der Reform führt die EU erstmals einen verbindlichen Solidaritätsmechanismus ein, um Asylsuchende innerhalb der EU zu verteilen. Der Solidaritätsmechanismus ist für die Schweiz nicht verbindlich, sie kann sich aber freiwillig daran beteiligen. Der Bundesrat sieht im Solidaritätsmechanismus eine Chance, das europäische Migrations- und Asylsystem nachhaltig zu stärken. Der Bundesrat unterstützt im Grundsatz eine Beteiligung der Schweiz am Solidaritätsmechanismus der EU. Er hat daher die Verwaltung beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten, wie eine Schweizer Beteiligung an diesem Mechanismus konkret aussehen könnte.
In der Vernehmlassung hatte rund die Hälfte der Teilnehmenden die Übernahme und Umsetzung der fünf EU-Verordnungen grundsätzlich befürwortet, darunter die Mehrheit der Kantone. Einige Kantone befürchten zusätzlichen personellen und finanziellen Aufwand. Andere Vernehmlassungsteilnehmende kritisieren, dass die Reform auf Abschottung und Abschreckung setze. Sie fordern, dass sich die Schweiz systematisch und konkret am neuen Solidaritätsmechanismus beteiligt.
Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens(pdf, 903kb)
Botschaft(pdf, 2695kb)
Entwurf Bundesbeschluss zur Übernahme und Umsetzung der AMMR-Verordnung und der Krisenverordnung(pdf, 292kb)
Entwurf Bundesbeschluss zur Übernahme der Rückkehrgrenzverfahrensverordnung(pdf, 154kb)
Entwurf Bundesbeschluss zur Übernahme und Umsetzung der Eurodac-Verordnung(pdf, 288kb)
Entwurf Bundesbeschluss zur Übernahme und Umsetzung der Überprüfungsverordnung(pdf, 325kb)
Adresse für Rückfragen:
Staatssekretariat für Migration SEM, medien@sem.admin.ch
Herausgeber:
Der Bundesrat
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement