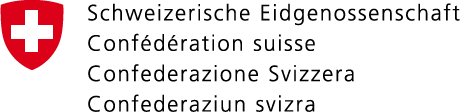Liebe Gersauerinnen und Gersauer,
liebe Anwesende
Vielen Dank für den herzlichen Empfang in eurer Gemeinde! Ich freue mich sehr, dass mich die «Altfrye Republik Gersau» zum 1.-August-Fest eingeladen hat.
Und ehrlich gesagt: Der Empfang war fast wie Heimkommen – überall diese schönen Tessiner-Flaggen!
Natürlich weiss ich, dass das keine Tessiner-, sondern Gersauer-Flaggen sind. Und ich habe mir sagen lassen, es gebe offiziell keinen Zusammenhang - auch wenn mein Heimatkanton mal euer Untertanengebiet war...
Trotzdem fühlt es sich ein bisschen an wie … zu Hause!
Gersau ist ja wirklich ein besonderer Ort. Eine Gemeinde, die einst ein eigener Staat war – mit eigener Regierung, eigener Verfassung, und das mitten in der Eidgenossenschaft. Eine Art Mini-Schweiz in der Schweiz. Klein, unabhängig, stolz – und doch Teil eines grösseren Ganzen. Eine schöne Metapher für unser Land heute – gerade auch in Europa.
Und wie jedes Land hat auch Gersau seine ganz eigenen Probleme:
- Ein Auto, das seit vier Jahren an einem Baum hängt – hoffentlich nicht als Mahnmal fürs Fahrverhalten im Kanton…
- Eine legendäre Wirtshausschlägerei mit zwei Touristen – die hat uns sogar in Bern beschäftigt…
- Und ein eigenes Verb: «gersauern». Für besonders eigenwillige Lösungen – … was das Auto wohl erklärt.
Liebe Gersauerinnen und Gersauer,
das hat mich an eine ganz andere Ecke der Schweiz erinnert: an Genf. Calvin-Stadt, UNO-Sitz – aus Sicht der Innerschweiz … fast schon Frankreich.
Und doch: Auch Genf hat sein eigenes Wort fürs eigenständige Handeln – die berühmte «Genferei». Das ist im Grunde dasselbe wie «gersauern» – mais en français.
Und so merkt man: Selbst Gegensätze wie Gersau und Genf haben etwas gemeinsam.
Gersau ist ja selbst ein Ort voller Kontraste:
- Jahrhundertelang nur mit dem Schiff erreichbar – und heute mit Blick auf den Bürgenstock, wo sich die Staatschefs der Welt treffen.
- Tief verwurzelt in der Geschichte der alten Eidgenossenschaft – und gleichzeitig Standort moderner Hightech-Firmen wie Camenzind oder Werth.
- Fest in der Tradition verankert – und doch offen für Neues, mit einem Augenzwinkern und einer gesunden Portion Selbstironie.
Zwischen Geschichte und Zukunft, zwischen See und Weltpolitik, zwischen Selbstbehauptung und Zugehörigkeit – da liegt Gersau.
Eine Gemeinde, die grösser ist, als es ihre Grösse vermuten lässt.
Mythen und Realitäten: Vom Bundesbrief 1291 bis zum Bundesstaat 1848
Wir feiern heute den Geburtstag unserer Schweiz. Und wie an jedem Geburtstag blickt man ein wenig zurück – und fragt sich:
Was hat uns stark gemacht? Was hat uns zusammengehalten?
Wer am 1. August die Geschichte der Schweiz Revue passieren lässt, begegnet unweigerlich einem spannenden Gegensatzpaar: Mythen und Wirklichkeit.
Wir erinnern uns an den Bundesbrief von 1291 – die symbolische Geburtsurkunde der Eidgenossenschaft. Ich empfehle allen den Besuch im Bundesbriefmuseum in Ihrem wunderschönen Kanton Schwyz – es lohnt sich.
Doch seien wir ehrlich: Seine heutige Bedeutung überstrahlt seinen ursprünglichen Inhalt bei weitem.
Drei Talschaften sicherten sich gegenseitige Hilfe zu und einigten sich auf gemeinsame Regeln. Nüchtern betrachtet war das ein pragmatischer Vertrag – kein Nationalepos. Aber gerade das macht ihn so wertvoll: Der Bundesbrief war eine konkrete Antwort auf konkrete Probleme. Etwa: Wer richtet, wenn ein Urner dem Schwyzer seinen Stall abfackelt?
Sein eigentlicher Wert liegt also nicht im Juristischen, sondern im Symbolischen. Er steht für den Willen zur Zusammenarbeit – für die Idee, dass man gemeinsam stärker ist. Solche Erzählungen stiften Identität. Mythen schaffen gemeinsame Bilder, geben Halt und verbinden Generationen. Es ist nichts Falsches daran, sie zu pflegen – im Gegenteil.
Wichtig ist nur, dass wir sie nicht mit der Realität verwechseln. Denn die Geschichte der Schweiz ist nicht vom Himmel gefallen. Sie war nie geradlinig, sondern voller Konflikte, Widersprüche und manchmal auch Zufälle. Und genau das macht sie so spannend – und so lebendig.
Eine faszinierende Schweizer Persönlichkeit war Guillaume Henri Dufour. Erst kürzlich haben wir seinem 150. Todestag gedacht. Dufour war gewissermassen der Inbegriff des Schweizer Gegensatzes – und zugleich ein Brückenbauer im wörtlichen wie im übertragenen Sinn:
Er war Ingenieur und baute echte Brücken. Aber er überbrückte auch Gegensätze.
Ein in Konstanz geborener Genfer mit französischen Eltern, der – gegen seinen ursprünglichen Willen – General der Schweizer Armee wurde und so zum Wegbereiter unseres Bundesstaats.
Er war Militarist – und zugleich Humanist. Internationalist – und Patriot. Kriegsgeneral – und Mitbegründer sowie erster Präsident des Internationalen Roten Kreuzes.
Und er war Kartograf. Mit seiner Dufourkarte - die erste vollständige topografische Karte der Schweiz (1865) - hat er nicht die Trennlinien im Innern der Schweiz hervorgehoben, sondern das Gemeinsame. Er hat das Land nicht nur vermessen – er hat es auch gezeichnet. Und mitgeformt. Eine Karte, die eine neue Realität entstehen liess: die moderne Schweiz. Aus Gegensätzen wurde Einheit.
So wie der Bundesbrief von 1291 eine pragmatische Antwort auf die Unsicherheiten seiner Zeit war, so war auch Dufour eine Antwort auf die Spannungen seiner Epoche.
Beide zeigen: In der Schweiz haben wir gelernt, dass Gegensätze keine Widersprüche sein müssen. Sie zeigen, wie wir uns der Realität stellen – und daraus Kompromisse schmieden.
Gerade weil wir Kompromisse eingehen und uns mit Augenmass weiterentwickeln, erscheint uns unsere Geschichte im Rückblick oft geradlinig. Doch wenn man genau hinschaut, erkennt man, wie weitreichend gewisse Entscheide waren.
Zum Beispiel:
- Die Einführung des Referendums 1874 – als Türöffner zur politischen Konkordanz.
- Oder die Bilateralen Verträge im Jahr 2002 – als kluge Balance zwischen europäischer Zusammenarbeit und nationaler Eigenständigkeit.
Ohne diesen Mut zur Anpassung an die Realität gäbe es die Schweiz, wie wir sie heute kennen, gar nicht.
Tradition und Fortschritt. Unabhängigkeit und Zusammenarbeit. Eigenständigkeit und Gemeinschaft.
Das alles steht bei uns nicht gegeneinander – sondern nebeneinander.
Das macht unsere Stärke aus!
Fortschritt und Krise: Ein realistischer Blick auf die Weltlage
In welcher Realität leben wir heute?
Auf der einen Seite können wir auf gewaltige Fortschritte zurückblicken: Die Menschen leben heute gesünder und länger als je zuvor. Seit Beginn letzten Jahrhunderts hat sich die weltweite Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Die Kindersterblichkeit ist dramatisch gesunken. Und der Anteil der Menschen in extremer Armut ist in den letzten 30 Jahren weltweit von 30 auf rund 8 Prozent gefallen.
Wir kommen also aus einer Zeit unvorstellbarer Verbesserungen – doch kaum jemand spricht darüber.
Fortschritt hat ein Imageproblem.
Gleichzeitig wächst das Gefühl, dass alles aus den Fugen gerät. Viele sehnen sich nach der «guten alten Zeit» – die oft gar nicht so gut war. Die Demokratie steht weltweit unter Druck: Nur noch acht Prozent der Menschheit leben in einer liberalen Ordnung.
Zölle werden erhöht, Handelsabkommen zerlegt, internationale Regeln ignoriert. Nicht das Recht regiert – sondern das Faustrecht. Gemeinsame Lösungen weichen dem Alleingang.
Grossmächte setzen ihre Interessen durch – notfalls mit Gewalt. Manche führen Kriege, um alte Imperien wieder auferstehen zu lassen.
Misstrauen, Neid und Abschottung – auch in der Schweiz
Und wir Schweizer?
Auch bei uns bröckelt das Vertrauen. Die Erwartungen sind grenzenlos, Rechte werden eingefordert – Pflichten verdrängt. Es herrscht ein Klima aus Misstrauen, Neid, Abschottung und Abkehr von Verantwortung.
Derweil streiten wir leidenschaftlich – über das Gendersternchen. Auch das darf man diskutieren – wenn man sonst keine existenzielleren Sorgen hat.
Doch ein nüchterner Blick auf die Realität zeigt:
Wir stehen an einem Wendepunkt. Zwischen Fortschritt und Rückschritt, zwischen globaler Kooperation und geopolitischer Rivalität. Zwischen demokratischer Erneuerung – und autoritärem Rückfall.
Viele denken in der Schweiz : ‹Wir können ein bisschen zuschauen, was passiert›» - sagte Bundeskanzler Walter Thurnherr bei seiner Verabschiedung im Dezember 2023 – und mahnte zugleich: «Doch das, was im Ausland passiert, wirkt sich auch auf uns aus».
Liebe Gersauerinnen und Gersauer,
Geschätzte Damen und Herren
Geopolitik ist kein Spektakel, das man aus sicherer Distanz bestaunen kann. Wir sind mittendrin.
In dieser Weltlage braucht es Klarheit. Und Haltung.
Die Schweiz ist ein ressourcenarmes Land – und stark auf die Welt angewiesen. Rohstoffe und Energie kommen aus dem Ausland. Viele Medikamente, Halbleiter und Maschinen ebenso. Unsere Wirtschaft lebt vom Austausch – mit Europa, den USA, China und vielen anderen. Ohne verlässliche internationale Beziehungen steht auch bei uns schnell alles still.
Auch im Alltag sind wir aufeinander angewiesen. Der Wirt braucht seine Lieferungen. Der Unternehmer Strom für seine Maschinen. Der Bauer Erntehelfer. Und wir alle – Ärztinnen, Pfleger, Medikamente, wenn wir krank sind.
Abhängigkeiten sind Realität – und wer sie erkennt, kann mit ihnen souverän umgehen. Genau das ist unsere Stärke: Wir gestalten unsere Abhängigkeiten so, dass sie tragfähig werden. Und daraus erwächst echte Unabhängigkeit.
Deshalb ist die Schweiz eines der globalisiertesten Länder der Welt. Weil wir wissen: Verträge schaffen Sicherheit. Regeln schaffen Verlässlichkeit. Eine offene Wirtschaft ist unsere Lebensader.
Rolle der Schweiz
Was tun wir also?
In erster Linie wollen wir nützlich sein für die Welt – nicht als Mahner, nicht als Macht, sondern als Brücke zwischen den Polen. Wie auf dem Bürgenstock, wo vor einem Jahr über den Frieden in der Ukraine gesprochen wurde. Oder kürzlich in Genf, wo sich Vertreter der USA und Chinas trafen, auf neutralem Boden. Unsere grösste Stärke liegt genau darin: für andere nützlich zu sein.
Denn nur so werden unsere Neutralität und unsere Grenzen auch in Zukunft respektiert. Nützlich zu sein ist keine Schwäche. Es ist unsere beste Lebensversicherung.
Und das, liebe Schwyzerinnen und Schwyzer, kennen Sie ganz genau.
Gerade der Kanton Schwyz, Wiege unserer Eidgenossenschaft, traditionsverwurzelt und manchmal ein bisschen eigensinnig, zeigt eindrücklich, dass Heimatliebe und Weltoffenheit keine Gegensätze sind. Im Gegenteil: Wer mit der Welt verbunden ist und trotzdem standfest bleibt, der weiss, wie man richtig gersauert.
- ·Denken wir zum Beispiel an die Japanesenspiele – ein einzigartiges Fasnachtsspektakel, das seit 1857 den «Kaiser Hesonusode» nach «Yeddo-Schwyz» bringt. Mit prächtigen Gewändern, viel Schalk – und einer guten Portion Selbstironie. Humor als Brücke zur Welt.
- Oder an die Max Felchlin AG in Ibach. Dort entsteht aus edlem Kakao feinste Schweizer Schokolade. Sie geht von hier hinaus in die Welt – in Confiserien von San Francisco bis Tokio. Globalisierung kann eben auch gut schmecken.
- Und auch kulturell schlägt Schwyz Brücken: Das Welttheater von Einsiedeln bringt seit über 100 Jahren das halbe Dorf auf die Bühne. Es ist mehr als nur Theater. Es ist ein Symbol: dafür, was entsteht, wenn Menschen gemeinsam etwas wagen. Wenn Herkunft, Titel oder Meinung keine Rolle spielen – sondern der gemeinsame Sinn.
Genau dieses Zusammenspiel aus Verwurzelung und Offenheit, aus Stolz und Neugier, aus Ernst und Humor – das macht die Schweiz aus. Damals wie heute, vor allem in unruhigen Zeiten.
Doch wir müssen uns dem bewusst bleiben. Jeden Tag aufs Neue. Und wir dürfen nicht den Sirenengesängen von Empörung, Mahnfinger, Belehrerei und moralischer Überheblichkeit erliegen.
Denn die Stärke der Schweiz war nie das laute Wort – sondern der stille Kompass.
Und das Vertrauen darauf, dass man mit Anstand und Augenmass weiter kommt als mit Gekläff.
Und das bringt effektiv Resultate: Trotz schwieriger Weltlage hat der Bundesrat in den letzten Monaten gleich mehrere grosse Verträge erfolgreich abgeschlossen: mit Indien, Malaysia, Südamerika (Mercosur) und dem Kosovo.
Und wir verhandeln weiter – intensiv, konkret, mit Augenmass. Mit den USA und mit China, unseren zweit- und drittwichtigsten Handelspartnern.
Mit grossem Bedauern mussten wir heute Nacht vom neuen Entscheid von Präsident Trump Kenntnis nehmen.
Aber wir lassen uns nicht entmutigen und streben weiterhin eine Einigung im Interesse beider Seiten an.
Und mit der EU – unserem wichtigsten Partner – hat der Bundesrat kürzlich eine Einigung zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs gefunden. Diese befindet sich nun in der Vernehmlassung.
Unser Ziel ist klar: Der bilaterale Weg mit der EU ist die beste Voraussetzung für unseren Wohlstand und unsere Unabhängigkeit. Gerade weil der Bundesrat weder einen Beitritt zur EU noch zum EWR anstrebt, ist die Weiterführung des bestehenden Wegs die pragmatischste Lösung.
Gerade in dieser raueren Welt tun wir gut daran, verlässliche und friedliche Beziehungen mit unseren Nachbarn zu pflegen. Das wissen auch die Araber, die dafür ein Sprichwort haben:
«Wer in Frieden mit seinen Nachbarn lebt, schläft ohne Angst.»
Und als Arzt kann ich es Ihnen versichern: Frieden ist auch gut für die Gesundheit - sehr gut sogar!
Geschätzte Damen und Herren
Liebe Gersauerinnen und Gersauer
Ich weiss: Sie gersauern mit Leidenschaft.
Und trotz kleiner Differenzen mögen Sie die Urner, die Nid- und Obwaldner – jedenfalls lieber als die Habsburger. Und selbst wir Tessiner scheinen Ihnen nicht mehr ganz so suspekt zu sein.
Als Schwyzer haben Sie der Eidgenossenschaft viel geschenkt: den Namen unseres Landes, das weisse Kreuz auf rotem Grund – mit kleiner gestalterischer Freiheit. Dafür danke ich Ihnen, im Namen des Bundesrats, von Herzen.
Doch so stark unsere Mythen sind – wir dürfen sie nicht mit der Realität verwechseln.
Am Ende geht es immer um einen Ausgleich der Gegensätze. Das war immer der Fall und es bleibt auch heute so.
Und das gilt auch für die Beziehungen mit unseren Nachbarländern – mit der EU. Das Thema wird in den nächsten Monaten für heftige Debatte sorgen. Machen Sie sich selber ein Bild: Sie finden die Faktenblätter und die Originaltexte auf unserer Webseite.
Verschiedene Meinungen sind nicht nur erlaubt – sondern erwünscht. Demokratie ist kein Kuschelkurs, sondern gelebter Dissens. Manchmal anstrengend – aber genau das ist ihre Stärke.
Demokratie braucht keine Betreuung von Besserwissern. Sie lebt davon, dass jede und jeder frei denkt, frei spricht und den Widerspruch aushält. Freiheit braucht Streit – ohne Hass.
«Machet den Zank nit!» richtete Niklaus von Flüe (1417–1487) im 15. Jahrhundert an die zerstrittenen Eidgenossen. Das galt damals wie heute.
Es geht also um unsere Sicherheit in einer unsicheren Welt. Es geht aber auch um unseren Wohlstand. … und – mit Verlaub – auch auf unseren Stolz. Denn Hand aufs Herz: Was wäre die Welt ohne ein Victorinox-Sackmesser in der Tasche?
Liebe Mitbürger
Ich bin gewiss kein Heiliger wie Niklaus von Flüe – es ist also höchste Zeit, dass ich meine Predigt hier beende!
Am 1. August feiern wir unsere Freiheit. Möge dieses Land auch in Zukunft von Freiheit und Vernunft geleitet sein!