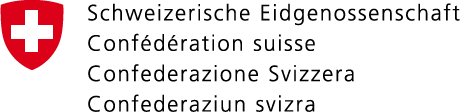Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Vielen Dank für die Einladung zu dieser wunderschönen Feier! Es ist für mich ein Privileg, dass ich am 31. Juli und am 1. August durch unser grossartiges Land reisen und eine ganze Reihe solcher tollen Anlässe besuchen darf – diese beiden Tage gehören für mich zu den schönsten im Jahr.
Bewusst besuche ich jeweils verschiedene Regionen und ganz bewusst entscheide ich mich für urbane Zentren ebenso wie für kleinere Orte in der Peripherie. Denn auch in unserer Bundesfeier spiegelt sich die grosse Vielfalt unseres Landes:
Wie es typisch ist für die Schweiz, sind die Feiern alle verschieden, alle sind auf ihre eigene Art gelungen, durch Landesteil und Region geprägt; einige feiern schon am Vorabend, am 31. Juli, andere feiern am Vormittag oder Mittag mit einem Brunch, andere am Abend mit Höhenfeuer, Feuerwerk und Lampions; man sieht alles: die Darbietungen der örtlichen Vereine, Musik und Gesang, vielleicht einen Gottesdienst oder eine lange Partynacht mit Tanz.
Aber etwas ist überall gleich: Man trifft auf fröhliche Menschen und eine gute Stimmung. Und überall auf motivierte Leute, die mit einem riesengrossen Engagement diese Feiern organisieren – und auf unzählige Helfer vor und hinter den Kulissen, die häufig freiwillig in Milizarbeit das alles überhaupt erst möglich machen … Auch von meiner Seite herzlichen Dank für diesen Einsatz!
Der Wellenschlag des Weltgeschehens
Geopolitik, Verwerfungen und Krisen
An einem Tag wie heute ist der Kontrast besonders scharf zu den oft düsteren Nachrichten aus aller Welt. Wenn wir dran denken, was alles nur allein in den letzten Jahren passiert ist, dann kann man ja wirklich den Eindruck bekommen, die Welt sei aus den Fugen geraten – all diese Verwerfungen und Turbulenzen und Krisen und Kriege:
Da war der Schock der Pandemie mit dem Lockdown; eine Weltwirtschaft, die in der Folge buchstäblich Kopf stand – eindrücklichster Indikator dafür: Der Ölpreis, der kurzfristig sogar negativ notierte. Dann der Zusammenbruch der globalen Lieferketten und die milliardenschweren Unterstützungspakete, die es brauchte, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen – was sich aber bald in vielen Ländern in zweitweiser hoher Inflation niederschlug.
Im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine; ein Blitz aus heiterem Himmel für alle, die glaubten, in Europa könne es nie mehr Krieg geben. Seither sprechen wir nach langen Jahren der Friedenseuphorie überall wieder von Aufrüstung.
Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen führten zu einer drohenden Energiemangellage; plötzlich herrschte in vielen Ländern Ungewissheit, ob es durch den nächsten Winter reicht. Die verbreitete Überzeugung, in Europa gebe es immer genügend Strom, lief an der Realität auf.
Vorletztes Jahr dann die fürchterliche Terror-Offensive der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und die Ausweitung des Krieges in den Libanon und bis nach Jemen – und im Juni die Eskalation mit dem Iran.
Die Kadenz der Eskalationen ist manchmal so hoch, dass man kaum mithalten kann und sie auch bald schon wieder vergessen sind – zum Beispiel anfangs Mai, als es zu einem kurzen militärischen Schlagabtausch zwischen Indien und Pakistan kam. Nun ist das zwar weit weg, aber es sind immerhin zwei Atommächte, die da aufeinander losgingen – da ist die Welt gerade noch knapp an etwas ganz Fürchterlichem vorbeigeschrammt.
In vielen Ländern ziehen am Horizont dunkle Wolken auf, was Wirtschaft und Wohlstand anbelangt. Weltweit steigt die Staatsverschuldung; der Schuldendienst frisst immer mehr der Einnahmen fortlaufend weg.
Die wirtschaftliche Situation in der Schweiz
Den Wellenschlag von Kriegen und Krisen spüren wir glücklicherweise oft nur abgeschwächt. Wir leben wir in einem Land mit guter Infrastruktur, funktionierenden Institutionen, mit Rechtssicherheit, mit Eigentumsgarantie, mit einer florierenden Wirtschaft, grossem Wohlstand, sauberer Umwelt und hoher Lebensqualität. Das zeigen regelmässig auch Studien, Umfragen und Rankings:
Beispielsweise misst die OECD die Lebensqualität weltweit für ihren Better Life Index; die Schweiz liegt da jeweils weit vorne. Entsprechend weisen Studien die Zufriedenheit mit dem jetzigen Leben als eine der höchsten in Europa aus.
Auch die wirtschaftliche Situation ist bei uns besser als in anderen Ländern: Beim BIP pro Kopf liegt die Schweiz gemäss Internationalem Währungsfonds auf den ganz vorderen Plätzen. Die Schweiz belegt im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit dieses Jahr wieder den ersten Platz, vor Singapur. Die Schweiz liegt auch bei der Innovation ganz vorne, pro Kopf werden bei uns die meisten Patente angemeldet, mehr als in den USA. Sogar in absoluten Zahlen liegt die kleine Schweiz weltweit auf dem siebten Platz.
Dank der starken Wirtschaft können wir uns ein hohes Lohnniveau leisten; die Schweiz verzeichnete auch im letzten Jahr ein Reallohnwachstum.
Unser Land ist viel weniger verschuldet als die meisten andern. Der Schweizer Franken gehört zu den stabilsten Währungen weltweit. Die Schweiz zählt insgesamt immer noch zu den steuergünstigen Ländern. Die Regulierungsdichte ist im Vergleich moderater.
Wir leben also zwischen diesen beiden Polen, diesen beiden Gegensätzen: Einerseits leben wir in einer Welt, die von rasantem Wandel erfasst ist; in einer Welt voller Unbeständigkeit, voller Turbulenzen und Verwerfungen; irgendwie immer am Rande der Eskalation zu etwas Schlimmem. Das ist eine Welt, die uns immer wieder ratlos zurücklässt – und ja, schon immer wieder auch Angst machen kann.
Und gleichzeitig leben wir in einem Land, dem es bis jetzt gelungen ist, den ärgsten Stürmen zu entgehen.
Der Wert der Heimat
Unser bewährtes Fundament
Mich erinnert das an die Gründungszeit unseres Bundes. Denn genau zu diesem Zweck wurde die Schweiz gegründet, um «im Hinblick auf die Arglist der Zeit … einander Beistand» zu leisten, wie es im Bundesbrief von 1291 heisst.
Das Angestammte, das Herkömmliche und Bewährte wird oft belächelt oder abgelehnt; zu Unrecht: es gibt uns einen gemeinsamen Nenner und gerade in turbulenten Zeiten Halt und Orientierung – ein Land ist nicht nur eine Fläche, nicht nur ein geographischer Ort. Ein Land ist gemeinsame Geschichte, geteilte Werte und das Gefühl von Zusammengehörigkeit.
Verlust der Heimat
Wir wurden Ende Mai dramatisch daran erinnert, dass man auch als Schweizer seine Heimat verlieren kann – und ich glaube, vielen ist durch dieses Ereignis die Bedeutung von Heimat wieder stärker bewusst geworden: Ohnmächtig mussten wir mitverfolgen, wie Blatten unter gewaltigen Schuttmassen begraben und wie dadurch den Blattnerinnen und Blattner ihr Dorf – ihre Heimat – genommen wurde.
Blatten ist in seiner Dimension ein ganz seltener Fall, aber auch anderswo in der Schweiz haben Menschen ihre Heimat verloren. Im Sommer vor zwei Jahren gab es Erdrutsche in Schwanden im Kanton Glarus; letzten Sommer Hochwasser und Überschwemmungen im Misox und im Val Maggia. Im bündnerischen Brienz müssen die Bewohner seit zwei Jahren mit Evakuierungen und der Ungewissheit leben, ob und wann sie jemals wieder in ihr Dorf zurückkehren können.
Aktuelle Diskussion über die Besiedlung der Berge
Solche Ereignisse sind ja schnell auch politisch. Und viel schneller, als ich gedacht hätte, gab es Stimmen, welche die Besiedlung unserer Bergtäler grundsätzlich in Frage stellten.
Es wurde angemahnt, der Schutz vieler Bergdörfer würde zu teuer. Man müsse auch nüchterne Kostenüberlegungen anstellen; man müsse darüber sprechen, was uns das wert sei, denn ohnehin fliesse schon viel Geld via Finanz- und Lastenausgleich in die Gebirgskantone.
Es brauche unpopuläre Ideen. Vielleicht müsse man einige Täler verwildern lassen oder aufforsten. Denn der Rückzug der Zivilisation reduziere auch das Schadenspotenzial. Wo weniger sei, da gehe auch weniger kaputt.
Die finanziellen Argumente vermischen sich rasch mit Ideologie: Die Alpen seien ein Mythos, würden als Freiluftbühne für Helden- und Heile-Welt-Sagen missbraucht …
Wer so argumentiert, der argumentiert am Wesen der Schweiz vorbei.
Die Schweiz als staatspolitisches Gleichgewicht
Heimat kann man nicht in Franken und Rappen beziffern. Es geht um das, was die Schweiz besonders macht – und auch um das, was uns als Land und Volk zusammenhält:
Die Schweiz besteht nicht aus boomenden Zentren und abgehängten, vernachlässigten Provinzen. Das im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die als Folge solcher Ungleichgewichte meist an grossen politischen Spannungen leiden.
Wir hingegen pflegen den Ausgleich und das Gleichgewicht zwischen Stadt und Land. Auch wenn das in einzelnen politischen Fragen nicht immer ganz einfach ist, wir stellen uns diesen Herausforderungen und finden am Ende einen ausgewogenen Kompromiss. Wir haben lange Übung damit. Denn schliesslich ist das Teil unserer Entstehungsgeschichte. Luzern war die erste Stadt, die sich dem Bund anschloss. Luzern hat die Eidgenossenschaft dadurch grundlegend verändert und ihr einen neuen Charakter gegeben: Seit dem Beitritt Luzerns, seit 1332 sind in der Eidgenossenschaft die städtisch und die ländlich geprägten Kantone gleichberechtigte Partner; Stadt und Land stehen dank dem Föderalismus in einem Gleichgewichtsverhältnis.
Historischer Exkurs: «Schweizer Krankheit»
Nein, Heimat kann man nicht in Franken und Rappen beziffern, aus staatspolitischen Gründen nicht, wie wir gerade gesehen haben, aber auch aus emotionalen Gründen nicht. Ich will diese emotionale Seite noch etwas vertiefen, denn die Verbundenheit zur Heimat muss lange ein spezielles Charakteristikum unseres Volkes gewesen sein – zumindest ergibt sich das aus den historischen Überlieferungen.
Denn dieser besonders starke und emotionale Bezug der Schweizer zu ihrer Herkunft war über Jahrhunderte Forschungsgegenstand und Diskussionsstoff von Ärzten, Naturwissenschaftlern und Philosophen – ich glaube, es lohnt sich, hier einen kurzen historischen Exkurs einzuführen:
Offenbar gab es über lange Zeit einen wissenschaftlichen Konsens, dass Schweizer, die ihre Heimat verlassen, leicht krank werden können. Ein besonders starkes Heimweh wurde als Schweizer Krankheit oder «mal du Suisse» bezeichnet.
Der Mediziner Johannes Hofer beschrieb 1688 in seiner Dissertation erstmals diese Krankheit; er verortete die Ursache des Heimwehs im Gehirn. Der angesehene Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer dagegen gab die Schuld dem Luftdruck, der in flachen Ländern höher sei als in den Alpen und deshalb die Blutzirkulation der Schweizer, die «den obersten Gipfel von Europa» bewohnten, behindere. Heimweh galt bei ihm als tödlich: Heilung bringe nur die Rückkehr in die Heimat.
Der Berner Mediziner und Universalgelehrte Albrecht von Haller hielt in seinem Artikel «Nostalgie, maladie du pays» in der Yverdoner «Encyclopédie» von 1774 Heimweh für eine Art Melancholie, die zu Schwäche, Krankheit und Tod führen könne, aber durch Hoffnung auf Heimkehr heilbar sei.
Auch der berühmteste Philosoph der Aufklärung, Jean-Jacques Rousseau, äusserte sich zum Thema: Er berichtet uns in seinem «Dictionnaire de musique» von 1768, dass es den Schweizer Söldnern in fremden Diensten bei Todesstrafe verboten war, den Kuhreihen zu singen oder zu spielen.
Denn die Söldner, so berichtet uns Rousseau, «die ihn sangen, zerflossen in Tränen, desertierten, oder es brach ihnen das Herz, so sehr weckte das Lied in ihnen das brennende Verlangen, die Heimat wiederzusehen».
Ende des 18. Jahrhunderts schrieb der Arzt Johann Gottfried Ebel, selbst helvetische Kühe erkrankten an Heimweh, hörten sie in der Fremde den Kuhreihen: «Sie werfen augenblicklich den Schwanz krumm in die Höhe, zerbrechen alle Zäune und sind wild und rasend.»
Jetzt ist die eine oder andere dieser Darstellungen im Stil ihrer Epoche vielleicht etwas gar farbig geraten, vielleicht ist beim einen oder andern dieser historischen Zitate eine gewisse Übertreibung dabei – zumindest bei den Kühen bin ich mir nicht ganz so sicher …
Aber Tatsache ist, dass die Verbundenheit unserer Vorfahren zu ihrer Heimat ganz offensichtlich grosse Beachtung fand. Natürlich – die Zeiten haben sich geändert; und trotzdem: Ich auf jeden Fall spüre diese Verbundenheit, wenn ich für eine längere Zeit weg bin. Mir ist es so ergangen, als ich für einige Zeit in den USA studiert habe, obschon mir Amerika sehr gefallen hat. Es kann in diesem fremden Land noch so schön und grossartig sein, all das Neue noch so aufregend und exotisch und überwältigend, aber bald vermisse ich meine Heimat.
Der alte Bund wird gelebt
Als UVEK-Vorsteher habe ich Blatten besucht, als die Geröllmassen das Dorf begruben. So ein Erlebnis geht unter die Haut. Ich habe seither viel daran denken müssen, auch an die Gespräche mit Blattnerinnen und Blattnern.
Es geht nicht nur um Materielles, so wichtig das auch ist, es geht um Andenken und Erbstücke; und es geht natürlich um diesen verlorenen Ort, wo man sich daheim fühlte; man versteht dann, dass Heimat nicht nur das eigene Haus ist, sondern zum Beispiel auch die Kirche, welche die Dorfgemeinschaft verkörpert, oder der Friedhof als Ort der Verbundenheit mit den Vorfahren, oder die Strassen und Winkeln und Wiesen, die alle voll sind mit persönlichen Erinnerungen bis zurück in die Kindheit …
Das ist ergreifend und wühlt auf – und doch: Trotz dieser Tragik gibt es auch einiges, das Mut macht und das gerade an einem 1. August erwähnt gehört, weil es Stärken unseres Landes zeigt:
Zuerst einmal die Blattner, die ihr Dorf wieder aufbauen wollen; sie sind fest entschlossen, sich in der Nähe der verlorenen wieder eine neue Heimat aufzubauen. Sie sind jetzt schon daran, den Neuanfang zu planen. Diese Tatkraft nach einem solchen Schlag ist bewundernswürdig. Dann die Hilfsbereitschaft im Land; Private und Gemeinden und Kantone haben gespendet, auch das Fürstentum Liechtenstein hat eine Spende überwiesen.
Und ich darf sagen, auch der Bund hat schnell reagiert: Am 21. Juni ist das Bundesgesetz über die Soforthilfe an Blatten in Kraft getreten. Weniger als ein Monat nach dem Ereignis. Das zeigt, dass schnelles und unkompliziertes Handeln möglich ist. Das spricht für unser System: Grundsätzlich ist es auf Bedachtsamkeit ausgelegt, aber wenn es wirklich dringend ist, dann geht es auch schnell. Vom Bund hat Blatten fünf Millionen Franken erhalten – das ist nicht eine Abgeltung des Schadens, das ist eine Soforthilfe; das ist einfach notwendige Liquidität für den Moment.
Oft vermisst man Wichtiges erst, wenn man es nicht mehr hat. Und oft zeigt sich Gutes erst in der Not. Ich glaube, wir dürfen sagen, Blatten hat uns gezeigt, dass die Schweiz eine funktionierende Gemeinschaft ist, dass bei uns sehr vieles sehr gut funktioniert und vor allem: Dass wir nach wie vor zusammenhalten, so wie unsere Vorfahren das 1291 gelobt haben.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Bundesfeier!