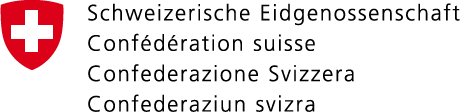Die Schweiz unterstützt die Ukraine bereits seit den 1990er Jahren bei den Reformbemühungen des Landes. Sie engagiert sich insbesondere für die Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, für effizientere öffentliche Dienstleistungen und für die Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums.
Erste Reaktion: Intensivierung und Anpassung der Unterstützung
Heute ist rund die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. In einer ersten Phase stand die Abklärung der Bedürfnisse im Vordergrund, sowie die Lieferung von Hilfsgütern. Nach dem 24. Februar 2022 erhielt das Engagement der Schweiz deshalb eine starke humanitäre Komponente. Diese war auf die thematischen Prioritäten des bisherigen Kooperationsprogramms abgestimmt, das folgende Schwerpunkte umfasste:
- Stärkung demokratischer Institutionen,
- Verbesserung der Gesundheit (Verbesserung der Grundversorgung),
- nachhaltige Stadtentwicklung (z.B. Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität),
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (landwirtschaftliche Unternehmen, Zugang zu Finanzdienstleistungen).
Dieses langfristige Engagement wird mit den notwendigen Anpassungen fortgesetzt.
- Angepasst wurde im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel ein Projekt zur Rehabilitation bei Kriegstraumata sowie zur Förderung von psychischer Gesundheit.
- Weiter setzt sich die Schweiz seit 2015 für die Digitalisierung und Dezentralisierung ein. Das Projekt E-Governance for Accountability and Participation (EGAP) bietet wichtige Verwaltungsdienste auf digitalem Weg an und erhöht so auch während des Krieges die Transparenz der Regierung, fördert die Teilnahme der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen und verringert Korruption.
- Ausserdem fördert die Schweiz den gleichberechtigten Zugang zu Bildung und die Stärkung der lokalen Gouvernanz. Seit 2022 umfasst dieses Projekt zusätzlich den Bau von Schutzräumen in Schulen und die Verteilung von Hilfsgütern an Binnenvertriebene in Schulen.
Angepasst wurden auch die Projekte zur städtischen Entwicklung und Mobilität, um den Binnenvertriebenen und den neuen sozioökonomischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen (z. B. barrierefreier Zugang zu Dienstleistungen und Transport).
Länderprogramm 2025-2028
Damit die Schweiz auch in Zukunft eine führende Rolle spielen kann, hat der Bundesrat entschieden, die Ukraine und die Region in der Periode 2025-2036 mit 5 Milliarden Franken zu unterstützen.
Für eine erste Phase bis 2028 sind 1,5 Milliarden Franken vorgesehen. Am 12. Februar 2025 verabschiedete der Bundesrat dazu ein «Länderprogramm Ukraine». Dieses fokussiert sich auf drei Wirkungsfelder:
- Wirtschaftliche Erholung
- Öffentliche Dienstleistungen
- Schutz der Zivilbevölkerung & Frieden
Bei der Umsetzung des Länderprogramms soll dem Schweizer Privatsektor mit seiner Expertise und seinem Fachwissen, aber auch mit seinen innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten beim Wiederaufbau in der Ukraine eine zentrale Rolle zukommen.
Das Länderprogramm Ukraine soll eine Umsetzung der Ukrainehilfe aus einer Hand ermöglichen. Die dazu eingesetzte Projektorganisation wird vom Delegierten des Bundesrates für die Ukraine, Jacques Gerber, geleitet und greift auf die bestehenden Prozesse und das Fachwissen der Bundesverwaltung zurück.
Länderprogramm Ukraine 2025-2028 (PDF, 24 Seiten, 1.4 MB, Deutsch)
Winterhilfe
Die gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur führten dazu, dass mehr als die Hälfte der Energieproduktion des Landes zerstört ist. Deshalb haben Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu Strom, Heizung und Wasser. Im Dezember 2024 hat der Bund ein Winter-Unterstützungspaket im Umfang von 45 Mio. Franken beschlossen. Dieses baut auf bestehenden Erfahrungen und Netzwerken auf. In den letzten zwei Wintern hat die Schweiz insgesamt 84,5 Mio. Franken für die Winterhilfe bereitgestellt, in deren Rahmen der Bundinsbesondere Projekte zur dringlichen Instandstellung zerstörter ziviler Infrastruktur (z.B. Notreparaturen im Energie-, Strassen- und Gesundheitsbereich) unterstützte.
Factsheet Winterhilfe (PDF, 1 Seite, 306.1 kB, Englisch)
Unterstützung durch Schweizer Expertinnen Spezialistinnen und Spezialisten Experten vor Ort
Februar 2022 entsendet die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) Spezialistinnen und Spezialisten des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe (SKH) in die Ukraine und nach Moldau, um dort die Schweizer Vertretungen zu verstärken und die humanitären Organisationen vor Ort (IKRK, UNO, NGO) zu unterstützen.
So konnten beispielsweise nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms zwei SKH-Fachpersonen für Engineering und WASH (Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene) bei kurz- und mittelfristigen Lösungsansätzen mithelfen, um die Auswirkungen der Zerstörung des Staudamms zu lindern. Seit Februar 2022 konnte das SKH im WASH-Bereich zwei Millionen Menschen unterstützen und plant bis 2027 weitere zwei Millionen zu erreichen.
Mit der wesentlichen Erhöhung der Schweizer Unterstützung der Ukraine wurde ebenfalls das Personal der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensförderung in der Schweizer Botschaft verstärkt. Dank der starken Präsenz der Schweizer Botschaft in Kyjiw kann die Qualität und Effektivität der Schweizer Projekte in der Ukraine kontrolliert und sichergestellt werden.
Finanzhilfe und multilaterale Unterstützung
Bei der Finanzhilfe nutzt der Bund Instrumente internationaler Organisationen wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Diese haben Fonds eingerichtet, um die Beiträge verschiedener Länder an die Ukraine zu bündeln.
Über den Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) hilft der Bund mit 54 Mio. Franken bei der dringlichen Instandsetzung zerstörter Energie-Infrastruktur. Ausserdem unterstützt der Bund mit 18 Mio. Franken den Ukraine Energy Support Fund, verwaltet durch das Energy Community Sekretariat, um beispielsweise Material bereitzustellen, welches für die Instandsetzung der Energie-Infrastruktur der Ukraine benötigt wird (nach Möglichkeit mit Schweizer Partnern).
Der Bund leistete zudem einen Beitrag von 3 Mio. Franken an die «Rapid Damage and Needs Assessment» Initiative der Weltbank, welche die durch den Krieg entstandenen Schäden ermittelt und evaluiert und festlegt, welche Reparaturen prioritär durchgeführt werden müssen.
Der Bund unterstützt den Fonds der EBRD («Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership») mit über 20 Mio. Franken. Mit diesem sollen in der Ukraine Zuschüsse für die Modernisierung und Wiederherstellung kommunaler Infrastruktur mit Fokus auf die Energieeffizienz vergeben werden.
Weiter unterstützt der Bund zwei Fonds der EBRD: Durch den Small Business Impact Fund setzt sich die Schweiz in der Ukraine für die Privatwirtschaft ein. Der Fonds verbessert die Rahmenbedingungen für KMU durch Beratung, Stärkung von Lieferketten, Zugang zu Finanzierungen oder die Einrichtung von Industrieparks. Die Schweiz trägt mit 11,5 Mio. Franken zu diesem Fonds bei. Auch der Multi-Donor-Account der EBRD fördert Reformen durch umfassendes politisches Engagement und Kapazitätsaufbau. Das SECO beteiligt sich daran mit 7,25 Mio. Franken.
Zusätzlich hat die EBRD eine Fazilität zur Wiederbelebung des Marktes für Kriegsrisikoversicherungen in der Ukraine eingerichtet. Diese Fazilität schafft einen Versicherungsmechanismus für Kriegsrisiken, um dem Rückzug internationaler Rückversicherungsunternehmen vom ukrainischen Markt seit Beginn der russischen Invasion entgegenzuwirken. Die Schweiz ist daran, die Beteiligung an dieser Fazilität vorzubereiten.
Über die IFC (Internationale Finanz-Korporation) unterstützte der Bund ein Mischfinanzierungsinstrument mit 9,5 Mio. Franken, über das Kredite an Bauern und Landwirtschaftsunternehmen vergeben werden können. Über den Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) investiert der Bund in den Horizon Capital Growth Fund, der Start-Ups im IT- und Exportbereich fördert und über den landwirtschaftliche Betriebe weiterhin Zugang zu Krediten haben.
Darüber hinaus unterstützt das SECO auch Projekte auf kommunaler Ebene in der Ukraine. Der IMF Ukraine Capacity Development Fund, an dem sich die Schweiz mit 7,5 Mio. Franken beteiligt, unterstützt die Wirtschaftsreformagenda der ukrainischen Regierung mit dem Ziel, die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität zu erhalten.
Neben konkreten Kooperationsprojekten ist auch die Steuerung multilateraler Instrumente wichtig. In diesem Zusammenhang vertritt die Schweiz die Ukraine im Exekutivrat der EBRD. Der Bundesrat hat entschieden, dass sich die Schweiz in der Höhe von 96,11 Mio. Franken an der Kapitalerhöhung der EBRD für die Ukraine beteiligt. Mit dem zusätzlichen Kapital sollen das Geschäftsumfeld reformiert und im Rahmen des Wiederaufbaus Klimainvestitionen in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor getätigt werden. Ausserdem leistet die Schweiz einen Beitrag von 6,4 Mio. Euro an die Finanzierung der Anteile der Ukraine an die Kapitalerhöhung.
Finanzielle Übersicht
Seit Februar 2022 hat der Bund rund 900 Mio. Franken für die internationale Zusammenarbeit in der Ukraine und in den Nachbarländern bereitgestellt. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Lieferung von Hilfsgütern, die Unterstützung der Gesundheitssysteme, der Dezentralisierung und der Digitalisierung, der Berufsbildung und von KMU oder die Stärkung des Agrarsektors. Die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren im Kontext der Ukraine hat dabei hohe Relevanz, weil bedeutende und qualifizierte Einsatzkräfte in der Ukraine vorhanden sind. Lokale Akteure bieten Netzwerke und Knowhow, sofortiges und flexibles Reagieren und ermöglichen zudem humanitären Zugang zu den letzten Kilometern in den Frontgebieten, die aus Sicherheitsgründen den meisten internationalen Akteuren unzugänglich sind.
Ukraine (Internationale Zusammenarbeit)
Ukraine (SECO)
Ukraine-Newsticker