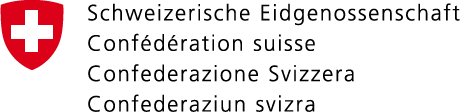Human Rights and Social Justice and Inclusion
In einem gemeinsamen Panel der Abteilung für Frieden und Menschenrechte (AFM) des EDA und des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) an der Geneva Peace Week diskutieren die Teilnehmenden die Frage, wie die Überprüfung der Friedensarchitektur die Rolle des Menschenrechtsökosystems in Prävention und Friedensförderung stärken kann. Im Mittelpunkt steht die diesjährige umfassende Überprüfung der UNO-Friedensarchitektur (Peacebuilding Architecture Review, PBAR). Dieser alle fünf Jahre stattfindende Prozess bewertet die Wirksamkeit bestehender Mechanismen zur Friedensförderung und identifiziert neue Ansätze zur Stabilisierung und Konfliktprävention. Das Panel knüpft an die Geneva Consultations an, die zu Beginn des Jahres vom EDA gemeinsam mit der Geneva Peacebuilding Platform (GPP) und Interpeace organisiert wurden. Ziel dieser Konsultationen war es, konkrete Handlungsempfehlungen für die Abschlussergebnisse der PBAR im Rahmen der UNO-Generalversammlung und des UNO-Sicherheitsrats zu entwickeln. Das Panel soll nun diese Diskussion weiterführen, indem es die Schnittstelle zwischen Menschenrechten und Friedensförderung in den Blick nimmt, Möglichkeiten für eine vertiefte Zusammenarbeit aufzeigt und so zu einem stärker integrierten Ansatz der Vereinten Nationen beiträgt.